
|
Musikantiquariat Dr.
Ulrich Drüner Tel.: +49-(0)711-486165 - Fax: +49-(0)711-4800408 Mitglied im Verband Deutscher Antiquare
e. V. |
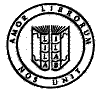
| Hauptseite | Abkürzungen |
Sonderliste
Autographen
Albumblätter,
kleine
Musikmanuskripte
und Musikerbriefe
Albumblätter, Musiker-Zeichnungen und kürzere Musikmanuskripte
Darunter viele aus der Sammlung von Carl Gurckhaus (1821-1884)
Der Musikalienhändler Carl Gurckhaus (1821–1884) trat bereits 1834 in die Leipziger Firma von Friedrich Kistner (1797–1844) ein, der seinerseits 1831 die Musikalienhandlung von H. A. Probst aufgekauft hatte und diese seit 1836 unter eigenem Namen weiterführte und zu einem bedeutenden Musikverlag ausbaute. Zwar übernahm nach Kistners Tod längere Zeit dessen Sohn Julius die Firma, zog sich aber 1866 aus dem Geschäft zurück (1868 verstorben); am 8. Dezember wurde der langjährige Geschäftsführer Gurckhaus Verlagseigentümer.
Gurckhaus nützte seine berufsbedingten Musikerbekanntschaften für ein hübsches Hobby: Er legte eine Sammlung musikalischer Stammbuchblätter an und forderte Komponisten, Virtuosen und Sänger auf, nach eigenem Gutdünken Noten und Sinnsprüche für ihn einzutragen. Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, verwendete Gurckhaus möglichst gleiche Blätter, zunächst schlichte, mit 12 blauen Systemen beidseitig bedruckte Notenblätter (Lithographie, 20,5×27cm). Bald aber ließ er für sich eigens Notenblätter herstellen, die nun einseitig mit 8 Systeme bedruckt waren und im unteren Bereich einen aufwändigen Zierumrahmung aufweisen (Rankenmotive; unten, Mitte: Aus dem Album von Carl Gurckhaus; Format 20,5×26,5cm).
Konzert- und Musiker-Alltag in der Arbeit zweier Musiker
Aus der Korrespondenz des Königlichen Musikdirektors Adolf Brandt (1838–1919) in Magdeburg und dessen Sohn, des Düsseldorfer Komponisten und Juristen Fritz Brandt (1880–1949).
Oftmals informieren Dokumente von vergleichsweise unbekannt gebliebenen Persönlichkeiten besser über den Musikalltag und den herrschenden Zeitgeist, als die Lebenszeugnisse der Zelebritäten. Dies wird auch durch die hier versammelten Briefe bestätigt, die sich im Wesentlichen von der Organisation von Konzerten in Magdeburg und Düsseldorf handeln.
Adolf Brandt war Professor und Königlicher Musikdirektor in Magdeburg und mit der Opernsängerin Hedwig Scheuerlein (1843–1927) verheiratet. Pazdírek weist veröffentlichte Kompositionen bis zur Opuszahl 52 nach, in denen sich das damals übliche Repertoire widerspiegelt: weltliche Vokalmusik (Lieder, Männer- und gemischte Chöre a cappella), einige Klavierstücke sowie Kirchenmusik (Motetten und Orgelwerke). Speziell für die weitverbreiteten Laienchöre waren etwa der »Sängergruß« oder die 53 Stücke umfassende »Sängerhalle« bestimmt, für den kirchenmusikalischen Alltag hingegen die »Sechzig kurzen leichten Vorspiele« für Orgel op. 2; auch zeitgemäße Referenzen an den Patriotismus fehlen nicht (»Mein Preußenland« oder »Am Sedan-Tage«).
Fritz Brandt war offenbar das einzige Kind und lebte bis um 1920 in Magdeburg, wo er wahrscheinlich bei seinem Vater Musikunterricht hatte. Kompositorisch scheint er nicht nur ambitionierter, sondern auch erfolgreicher als sein Vater gewesen zu sein; u. a. ist bereits für 1913 die Uraufführung von »Mistral« nach einem Text von F. Nietzsche für Barition und Orchester in seiner Heimatstadt nachweisbar, für 1919 zwei weitere große Werke und 1921 ein Streichquartett auf dem Tonkünstlerfest in Nürnberg. Dennoch studierte Fritz Jura und hat beruflich dann diese und nicht die musikalische Laufbahn eingeschlagen. 1914–18 war er Kriegsteilnehmer und hat (wahrscheinlich kurz nach Kriegsende) Dora Bosse geheitratet, mit der er 1920 eine Tochter (Silvia) hatte; beide spielen in der Korrespondenz ebenfalls eine Rolle.
Musikerbriefe an diverse Empfänger
| Hauptseite | Seitenanfang | Abkürzungen |