
|
Musikantiquariat Dr.
Ulrich Drüner Tel.: +49-(0)711-486165 - Fax: +49-(0)711-4800408 Mitglied im Verband Deutscher Antiquare
e. V. |
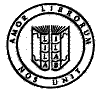
| Hauptseite | Abkürzungen |
Sonderliste
Autographen
Albumblätter,
Musiker-Zeichnungen,
Widmungsexemplare und kleine Musikmanuskripte
| d'Albert - Offenbach | Pressel - Ysaye | Briefe |
d’ALBERT, Eugen (1864–1932): Notenzeile mit vier Takten aus »Tiefland« und der Widmung Herrn Hans Budick [?] zur freundlichen Erinnerung, mit eigenh. Unterschrift und Datierung: z. Z. Rapallo 3/3/[19]27. Hübsche Sammlerkarte 9,5×14,5cm.
Bestell-Nr.: 56/2 Preis: € 180,--
D’Albert war lange Zeit gleichermaßen als Pianist und als Komponist berühmt. Natürlich musste er ein Notenzitat aus seiner einzig bekannt gebliebenen Oper (»Tiefland«, 1903) auswählen.
ASSMAYER, Ignaz (1790–1862): Eigenh. Albumblatt m. U. für Carl Gurckhaus, o. O., 25. Februar 1855, mit 24 Takten des 4stimmigen gemischtnen Chors »Er ist besiegt durch Gottes Macht« Aus dem Oratorium »Das Gelübde od. Jephta [...] comp. 1831 (Chorpartitur, Anmerkung: mit Hinweglassung des Orchesters). 1 Bl. mit 2 vollständig beschriebene Seiten (20,5×27cm).
Bestell-Nr.: 56/3 Preis: € 200,--
Assmayer war Schüler Michael Haydns (auch von Albrechtsberger und Eybler) und als Vizehofkapellmeister in Wien tätig; er komponierte überwiegend Kirchenmusik: Alle seine Arbeiten sind rein und correct geschrieben, ermangeln aber besonderer schöpferischer Eigenthümlichkeit (Mendel, 1870).
BARTOK, Béla (1881-1945): Eigenh. Album- und Korrekturblatt mit 6-taktigem Notenzitat in Blaustift, auf handgezogenen Notenlinien (eine irrtümlich sechste Linie ist ausgestrichen!), überschrieben „Regös-ének“ [= „Eingangslied“] und darunter signiert in sorgfältig gezeichneten kyrillischen Buchstaben in Schwarz „Bartok Bela“; unregelmäßiges, auf einer Seite von Hand schräg abgetrenntes Blatt (13 cm lang, Höhe 8,5 - 9,8 cm). Die Rückseite enthält eine zehnzeilige eigenh. Korrekturanweisung Bartóks, ebenfalls mit kurzem Notenzitat.
Referenz-Nr.: 56/4 Preis: € 1.900,--
Der Text der Rückseite ist in englischer Sprache, was eine Datierung des Blattes in die amerikanische Exil-Zeit nahelegt (1940-45); die Zitierung eines Regös-ének und vor allem die kyrillische Signatur erlauben eine noch engere zeitliche Eingrenzung auf Bartóks Arbeitsperiode an der Columbia University in New York (1941-42), wo er für ein Jahresgehalt von $ 3000 an der Transkription serbokroatischer epischer Gesänge und Volkslieder aus der Sammlung Parry arbeitete (Veröffentlichung erst postum, N. Y. 1951). Diese Arbeit erlaubte Bartók das Überleben im Exil, bevor er 1943 seinen ersten amerikanischen Kompositionsauftrag erhielt: das von S. Koussevitzky bestellte Concerto für Orchester, welches die biographisch bedingte dreijähriger Schaffenspause beendete und das fulminante Spätwerk einleitete.
Die Rückseite enthält einen längeren Korrektur-Text, in dem Bartók die Verkürzung von Notenhälsen verlangt: „That ist he only way to place properly the fingering and the missing slur.“ In einer weiteren General remark verlangt der Komponist allgemein kleinere Notenköpfe und kleinere Fingersatz-Ziffern. Die Rückseite könnte als erste entstanden sein; die Vorderseite, die eher den Charakter eines „Albumblatts“ hat – allerdings auf ziemlich zufälligem Material –, könnte als Souvenir für einen Verlagsmitarbeiter nachträglich hinzugekommen sein.
Dokumente Bartóks mit Musikzitaten sind außerordentlich selten!
BARTOK, Béla (1881-1945): Eigenh. Notenblatt mit 8 Takten Musik in Bleistift auf handgezogenem, sehr unregelmäßigem Notensystem mit einigen Anmerkungen; auf einem ausgeschnittenen Formular der New School for Social Research, N. Y., 1 Bl. breites 8vo (15 x 14,8 cm; am oberen Rand von fremder Hand: „Bartók“), ca. 1941-42.
Referenz-Nr.: 56/5 Preis: € 850,--
Typisches Dokument, das zeigt, wie sehr Bartók schon früh zum Objekt des „Reliquiensammelns“ geworden ist. Es handelt sich hier um ein Arbeitspapier, für das ein wohl aus dem Papierkorb zufällig herausgezogenes Blatt diente, um eine Volksmelodie harmonisch zu analysieren. In der Tat weisen Bartóks eh. Anmerkungen „g1 a1 b1b c2“, „D 2 b3 4“ und „8, VII-8“ offensichtlich auf harmonische Strukturen hin, die den Komponisten und Volksliedforscher interessierten.
Einen Hinweis auf das Lied selbst gibt Bartók nicht, aber die melodische Struktur (d-d-d-c/d-d-d-c/d-e-f-d/d-g-c/b…) weist deutlich auf die südosteuropäischen Spottlieder des Volksbrauches. Die Niederschrift ist demnach ebenfalls auf die Jahre 1941-42 anzusetzen.
BAZIN, François (1816–1878): Eigenh. Albumblatt m. U. für Carl Gurckhaus, o. O., undatiert, mit acht Takten einer Vokalkomposition (»Regardez, Arthur, ces deux fleurs jolies«; ohne Titel; vermutlich Klavierauszug, Rollenbezeichnung der Gesangstimme: Arthur). 1 Blatt quer-4to (20,5×27cm).
Bestell-Nr.: 56/7 Preis: € 150,--
Bazin studierte u. a. bei Halévy und Berton, wurde schnell ein erfolgreicher Komponist und einer der maßgeblichen Pädagogen des Pariser Conservatoire (der es sich leisten konnte, Massenet als Schüler abzulehnen); wegen seiner konservativen Haltung wurde er von Neuerern wie Berlioz heftig angegriffen und verspottet. – Bei dem obigen Arthur-Zitat handelt es sich möglicherweise um eines der unveröffentlichten Bühnenwerke, die in MGG/2 erwähnt werden. Unter den veröffentlichten, auch unter den Liedern, ist keines im Zusammenhang mit der Arthus-Sage.
„Nur Leitmotive Wagners hört man dort, /
Schon deshalb musst ich schleunigst wieder fort“
BRUCH, Max Felix (geb. 1884): Scherzgedicht. Reinschrift, Dresden, 1. April 1904. 4 S. quarto auf 2 leicht gebräunten Bll., jeweils Querriss mit transparentem Klebestreifen repariert. Schöne Handschrift.
Bestell-Nr.: 57/23 Preis: € 100,--
Bei dem »Dichter« handelt es sich um Max Bruchs 1884 geborenen Sohn Max Felix, der Klarinettist, Komponist und Kapellmeister war. Im Verlauf des Textes redet er seine Eltern zwei Mal indirekt an: Dem Vater sag‘ ich dieses ... bzw. Zu meiner Mutter sprech ich ... Hintergrund ist offenbar sein längerer Besuch bei einer Familie Meysenbug, wobei nicht klar ist, ob es sich um Verwandte von Malwida von Meysenbug (1816–1903), der aus dem Wagner/Nietzsche-Umkreis bekannten Schriftstellerin und Frauenrechtlerin, handelt. Bruch entrüstet sich nicht nur über bestimmte Gewohnheiten seiner Herbergsfamilie, wobei er auf einzelne Personen näher eingeht, sondern auch zum Schein mehrfach über deren progressiven Musikgeschmack: Mit Meysenbug’s Musik ist’s ganz was Mises, / Nur Leitmotive Wagners hört man dort, / Schon deshalb musst ich schleunigst wieder fort. An anderer Stelle heißt es über eine Tochter des Hauses: Die Vera tut mir tief im Innern leid, / Denn sie ist eine schrecklich schlimme Maid, / Sie schwärmt nur für Wagner und für Strauss / Und spielt den Walzer aus der „Fledermaus“. Am Schluss entpuppt sich das Ganze als launiges Abschiedsgeschenk: Dies aus tiefster Seele kommende Gedicht den lieben Meysenbugs in Erinnerung schöner gemeinsamer Stunden und in Freundschaft und Dankbarkeit; ergänzt wird dies durch den Hinweis auf das Datum: 1. April 1904 (entschuldigt alles).
DORN, Heinrich: Prachtvolles eigenh. Albumblatt m. U., Berlin, 21. März 1856, mit fünftaktigem Notenzitat aus einem nicht bezeichneten Werk, 1 Bl. 4to (27 x 20 cm), bestens erhalten.
Bestell-Nr.: 56/12 Preis: € 240,--
Der mit Largo bezeichnete Notenausschnitt ist auf acht Systemen geschrieben und für viergeteilte Violinen, 2 Viole, 2 Celli (mit CBasso) bestimmt. Es könnte sich um den Anfang des Octett zum Rigaer Musikfest op. 21 handeln, das um 1836 entstand. Doch ist es wahrscheinlicher, dass Dorn im Jahr 1856 aus einem aktuelleren Werk zitiert, wobei zu jener Zeit eigentlich nur die Opern Die Nibelungen (1854) oder Ein Tag in Russland (1856) in Frage kommen. Kammer- und Orchestermusik ist in Dorns damaliger Opernphase nicht nachweisbar.
EGK, Werner (1901–1983): Eigenh. Unterschrift mit Notenzeile (3 Takte eines nicht genannten Werkes). [1970]. Weißer, dünner Karton, 10,5×15cm.
Bestell-Nr.: 56/13 Preis: € 70,--
Egk wurde vorwiegend für seine musiktheatralischen Werke bekannt.
ELWART, Antoine-Elie (1808–1877): Albumblatt, datiert 22. Januar 1838 (einseitig handrastriert mit 8 Systemen), quer-4to (23,5×30cm). Gering braunrandig. – Enthält das Lied À la mélodie (»Divine mélodie«), mit Klavier- oder Harfenbegleitung (nur in Akkoladen zu 2 Systemen notiert – Vokalpartie in den Klavier- bzw. Harfensatz eingezogen).
Bestell-Nr.: 56/14 Preis: € 150,--
Elwart war u. a. Schüler von Fétis und Le Sueur und als Komponist, Musikschriftsteller und –theoretiker tätig.
GADE, Niels Wilhelm (1817-1890): Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell... Op. 42. Leipzig, Breitkopf & Härtel, Pl.-Nr. 10631 [1864]. 35 S. Klavierpartitur, teilweise stockfleckig. Auf dem vorderen Originalumschlag (identischer Titelaufdruck; Rückblatt verloren) befindet sich eine eigenhändige Widmung in dänischer Sprache mit Unterschrift „Niels W. Gade“.
Bestell-Nr.: 57/39 Preis: € 180,--
GOLDSCHMIDT, Sigismund (1815–1877): Eigenh. Unterschrift mit Notenzeile (4 Takte der rechten Hand, wahrsch. Beginn einer Oktavenetüde für Klavier), mit Datierung Leipzig, 23. Sept. 1849. Schwach gebräuntes Bl., 6,5×19,5cm.
Bestell-Nr.: 56/17 Preis: € 60,--
Zwischen 1845 und 1849 lebte der gefeierte Pianist, dessen Kompositionen ebenfalls eine vielversprechende künstlerische Zukunft verrieten, in Paris. Trotz so glänzender Auspicien verschwand G. meteormässig vom öffentlichen Schauplatze, indem er das wohlsituirte kaufmännische Geschäft seines Vaters in Prag übernahm und seitdem nur noch als Mäcen der Kunst, nicht als ausführender Künstler sich bethätigt (Mendel, 1874).
GOUVY, Theodor (1819–1898): Eigenh. Albumblatt m. U. für Carl Gurckhaus, Leipzig, 3. Februar 1844, mit den ersten neun Takten einer Sonate p[ou]r le Piano (wahrsch. 1. Satz). 1 S. (20,5×27cm).
Bestell-Nr.: 56/18 Preis: € 180,--
Gouvy lebte überwiegend in Paris; er stand in der Nähe von Mendelssohn, Schumann und Brahms. Ein kürzlich auf Tonträger erschienenes Requiem erweist Gouvy als erstaunlich gut schreibenden und tief empfindenden Musiker, der in der „zweiten Reihe“ einen der ersten Plätze verdient. – Mendel schätzte an ihm auch, dass er das Deutsche so spricht, dass der Ausländer in ihm nicht zu erkennen ist.
GRELL, Eduard August (1800–1886): Eigenh. Albumblatt m. U. für Carl Gurckhaus, o. O., 8. September 1857, mit vier Takten einer Basspartie (»Wende von mir den falschen Weg …«) ohne Begleitung. ! S. quer-quarto (20,5×26,5cm). Tinte schwach durchscheinend.
Bestell-Nr.: 56/19 Preis: € 250,--
Der Zelter-Schüler Grell war zunächste Vizedirigent der Singakademie in Berlin und seit 1853 deren Leiter.
GUMBERT, Ferdinand (1818–1896): Eigenh. Albumblatt m. U. für Carl Gurckhaus, Berlin, 19. März 1856, mit der vollständigen Vokalpartie eines Liedes Aus opus 30. Gedicht von [Gottfried] Kinkel (»Und du, mein Herz, in Abendstille«). 1 S. in quer-4to (20,5×27cm).
Bestell-Nr.: 56/20 Preis: € 180,--
Dieses Stück ist in Berlin bei Schlesinger (um 1845) zusammen mit dem Lied »O lieb, so lang du lieben kannst«) erschienen. Im Allgemeinen haben seine Lieder ein ungewöhnliches Glück gemacht, […] die bis in die untersten Schichten des Volkes drangen und zum Leierkasten gesungen wurden. […] Im Ganzen haben seine Lieder-Compositionen einen weichen, schwermüthigen, sentimentalen Charakter … (Ledebur, 1861).
HINDEMITH, Paul: Das Unaufhörliche. Oratorium. Text von Gottfried Benn. Mainz: Schott, Verl.-Nr. 32937 (Edition Schott No. 3258), 1931. 2 Bll. (Titel, Inhalt, Besetzung), 139 S. Klavierauszug, folio, leichte Gebrauchsspuren. Ohne vorderen Umschlag. Die Partie des Solo-Soprans ist mit Rotstift markiert. Auf der Rückseite des Titelblatts befindet sich eine autographe, undatierte Widmung des Komponisten: Zur freundlichen Erinnerung an die Mainzer Aufführung Paul Hindemith.
Bestell-Nr.: 57/50 € 450,--
Erstausgabe des Klavierauszugs. (Die Partitur und das Aufführungsmaterial waren nur leihweise erhältlich.) – Nachdem es 1930 zwischen Hindemith und Brecht zum Bruch gekommen war, suchte sich der Komponist einen anderen »modernen« Dichter und fand ihn in Gottfried Benn. Das erste Ergebnis waren drei Chorsätze, denen dann mit »Das Unaufhörliche« ein geradezu sinfonisch geweitetes, abendfüllendes Werk folgte (mit monumentalem C-Dur-Schluss!); den Text hatte der Dichter in Hindemiths Auftrag geschrieben. Benn erläuterte während der Entstehung brieflich: Dieser Text, genannt ›Das Unaufhörliche‹, ist kein Lehrstück, sondern mehr eine Dichtung. Der Name soll das unaufhörlich Sinnlose, das Auf und Ab der Geschichte, die Vergänglichkeit der Größe und des Ruhms, das unaufhörlich Zufällige und Wechselvolle der Existenz schildern, vielmehr lyrisch auferstehen lassen. Es drückt sich darin nicht zuletzt die klare Abgrenzung gegenüber Brechts engagiertem Kunstverständnis aus, was Benn gerade wegen Hindemiths vorausgegangener Zusammenarbeit mit diesem für notwendig hielt. Es muss sich damals um einen wirklich gelungenen Schöpfungsprozess mit einem gegenseitigen Nehmen und Geben gehandelt haben, was sehr selten ist. Hindemith zeigte sich ebenso für Benns Wünsche offen, wie umgekehrt. Die Uraufführung fand am 21. November 1931 unter der Leitung von Otto Klemperer in Berlin statt.
HÖLZEL, Gustav (1813–1883): Eigenh. Albumblatt m. U. für Carl Gurckhaus, Wien, 24. Februar 1860, mit einem Ausschnitt aus einem Lied für Bass und Klavier (Titel unklar [Rom?] – aus den Reisebildern J. S. Tauber: »Und doch so groß noch als Ruine«). Auf schönem Albumblatt-Vordruck mit reichem Zierrahmen, quer-4to (20,5×26,5cm). Tinte durchscheinend.
Bestell-Nr.: 56/23 Preis: € 120,--
Hölzel trat zwischen 1841 und 1862 in der Wiener Oper auf; er war überdies der erste Beckmesser in der »Meistersinger«-Uraufführung (München 1868). Unter seinen Kompositionen ließ sich dieses Lied nicht nachweisen.
HUMMEL, Johann Nepomuk (1778–1837): Eigenh. Albumblatt m. U., offenbar für ein Poesiealbum angefertigt und fast kaligraphisch ausgeführt, mit der Datierung: Weimar, 4ter Sept. 1833. 1 Bl. 8 x 12,5 cm; verso Spuren, die auf die Befestigung auf einem zusätzlichen Blatt hinweisen.
Bestell-Nr.: 56/26 Preis: € 450,--
Sehr hübsches Zeugnis einer längst untergegangenen Kultur der Verbundenheit, die sich häufig in bürgerlichen Lebensregeln manifestierte; so auch in dem von Hummel niedergeschriebenen Text: Verträglichkeit, Aufrichtigkeit und Biedersinn / sind die festesten Stützen der Freundschaft und der reinsten Harmonie. Mit diesem Lehrsatz empfiehlt Ritter Hummel seinen Sohn dem nicht genannten Adressaten.
HÜNTEN, Franz (1793–1878): Eigenh. Albumblatt m. U. für Carl Gurckhaus, o. O., undatiert, mit den ersten vier Takten eines Klavierstücks in a-moll (Allegro). Auf schönem Albumblatt-Vordruck mit reichem Zierrahmen, quer-4to (20,5×26,5cm). Tinte schlägt etwas durch.
Bestell-Nr.: 56/27 Preis: € 250,--
Schillings Encyklopädie weist darauf hin, dass Hünten als Komponist viele Freunde unter namentlich den […] Dilettanten erworben habe; und das mit Recht: seine Sachen sind nicht allzu schwer, gefällig, wie Liebhaber es eben wollen, und dabei auch nicht schlecht, Wie Verständige es fordern. Hünten, der lange Zeit in Paris lebte, gehört zu den bedeutenden Pianisten seiner Zeit.
KIENZL, Wilhelm: Eigenh. Albumblatt m. U., 30. Oktober 1930, mit achttaktigem Notenzitat aus Kienzls Hauptwerk, der Oper Der Evangelimann; Kärtchen in querformat (13 x 4,5 cm).
Bestell-Nr.: 56/29 Preis: € 250,--
Das Kärtchen entstammt der Serie „Lesezeichen“; die Rückseite enthält eine gedruckter Abbildung des Komponisten, was das Stück besonders reizvoll macht. Der Evangelimann wurde am 4. Mai 1895 am Königlichen Opernhaus zu Berlin uraufgeführt und machte den Komponisten über Nacht weltberühmt (5300 Aufführungen bis 1935; jüngere Inszenierungen sind bis 1980 nachweisbar).
KÜCKEN, Friedrich Wilhelm (1810–1882): Eigenh. Albumblatt m. U. für Carl Gurckhaus, Stuttgart, 4. Dezember 1853, mit den ersten acht Takten des Liedes Das Sternchen. Gedicht von Roquette (»Du kleines blitzendes Sternchen«). 1 Blatt in quer-4to (20,5×27cm).
Bestell-Nr.: 56/30 Preis: € 250,--
Kücken galt als einer der beliebtesten Lieder-Componisten Deutschlands und einige seiner Lieder sind Volkslieder geworden (Ledebur, 1861). Zu diesen Evergreens, deren „Verfallsdatum“ gleichwohl um 1900 anzusetzen ist, gehörte auch das vorliegende. Es ist auf einen Text des Modedichters Otto Roquette komponiert und war offenbar damals noch nicht veröffentlicht. Später wurde es die Nr. 1 in »Drei Lieder« op. 61; Leipzig: Kistner (1854).
LOBE, Johann Christian (1797–1881): Eigenh. Albumblatt m. U. für Carl Gurckhaus, Leipzig, 23. Mai 1855, mit einem acht Takte umfassenden Canon (untextiert). 1 Bl. quer-4to (20,5×27cm).
Bestell-Nr.:56/31 Preis: € 120,--
Lobe fügte seiner musikalischen Niederschrift eie Maxime hinzu: Mancher Künstler schilt die Regel aus keinem andern Grunde, als weil er sich vor ihr fürchtet, und den Muth oder die Geschicklichkeit nicht besitzt, sie überwinden zu lernen. Wenn man das Blatt um 180° dreht, erhält man wieder dasselbe Notenbild. – Lobe war ein renommierter Flötist und trat auch kompositorisch hervor (u. a. Opern). Am bekanntesten dürfte er aber als Musikschriftsteller sein; er veröffentlichte viele Artikel in der AMZ, die er ab 1846 bis zu ihrem Ende (1848) leitete.
LOEWE, Carl (1796–1869): Honorarabrechnung zu einem Logen=Concert, mit eigenh. Kostenaufstellung m. U., undatiert [1850/60?]. 1 S., quer-octavo (1 Bl., 14×22cm). Eine Faltung, unbedeutender Randeinriss.
Bestell-Nr.: 57/64 Preis: € 650,--
Enthält die Namen von sieben Herren – Ruel, Wichert, Wild, Lemser, Dannenberg, Treder und Peters – sowie als achte Position den Concert-Diener, der immerhin das zweithöchste Honorar erhalten hat. Der Titel könnte auf ein Konzert in einer Freimaurer-Loge hindeuten, wobei von entsprechenden Beziehungen Loewes allerdings nichts bekannt ist. Am oberen Rand ist Belag 15 eingetragen, wodurch sich unser Blatt als Teil einer längeren Abrechnungsdokumentation zu erkennen gibt. Die beiden ersten Personen haben demnach an drei Proben, die anderen an einer Probe nebst der Aufführung teilgenommen. Bei Trede) sind noch vier Gehülfen ausgewiesen.
Eine bisher unbekannte Fassung von Löwes “Maria Stuart”
LOEWE, Carl : Chanson de Maria Stuart (»En mon triste et doux chant«). Lied mit Klavierbegleitung (ohne Opuszahl). Autographe Reinschrift [nach 1842]. 9 Seiten in querfolio (34 x 27 cm) auf 3 Doppelblättern aus Notenpapier (3×3 Systeme, maschinenrastriert, o. WZ). Unbedeutend gebräunt, Falz des äußeren Doppelblattes teils gelöst. Das ganze Manuskript war früher zusätzlich quer gefaltet.
Referenz-Nr.: 57/65
Unser Autograph erweist sich als eine hochbedeutende Quelle für dieses zu Löwes Lebzeiten nicht gedruckten Lieds; erst dreißig Jahre nach des Komponisten Tod wurde es erstmals im Rahmen der »Gesamtausgabe der Balladen, Legenden, Lieder und Gesänge für eine Singstimme« (2. Band, 1899) publiziert (mit dem deutschen Titel Gesang der Königin Maria Stuart auf den Tod Franz II. und zusätzlichem deutschen Gesangstext »In meines Herzens Trauerlied«). Max Runze, der Herausgeber der Gesamt-Ausgabe, nennt als Fundort seiner Veröffentlichung eine Handschrift die Königliche Bibliothek (Berlin); er vermutet, dass sich Loewe in diesem Gesange auf altfranzösische Melodien und Rhythmen bezogen habe, worauf auch im Untertitel der Notenwiedergabe hingewiesen wird: Nach Art der altfranzösischen Volkslieder. Der Charakter des Stücks weicht vom bekannten Stil Loewes stark ab. In der GA ist noch die aus der verwendeten Quelle übernommene Zueignung angegeben: Seiner lieben Tochter Julie von Bothwell gewidmet (die Familie Bothwell soll weitläufig mit Maria Stuart verwandt gewesen sein). – Vermutlich stützte sich Loewe auf den französischen Originaltext, der innerhalb der Sammlung »Recueil de chants historiques français« (Le Roux de Lincy, 1842) erschienen war; die deutsche Übersetzung in der GA (mit dem Bearbeitervermerk: von A. R.) dürfte erst hierfür angefertigt worden sein. In die Gesangspartie wurden die dabei notwendigen Änderungen und Ergänzungen in Kleinstich eingefügt.
Obwohl unser Autograph in seiner musikalischen Grundsubstanz der Berliner (und damit der gedruckten) Fassung im großen Teilen entspricht, muss hier auf wichtige Abweichungen hingewiesen werden:
1. Unser Manuskript ist um 56 Takte länger und hat 134 statt 78 Takte in der Berliner Fassung, in welcher der dritte Teil (von vier Hauptabschnitten) gänzlich fehlt!
2. Ein fundamentaler Unterschied ist ferner bei der Textierung festzustellen: Während die GA die beiden ersten Teile (Larghetto 12/8 bzw. 6/8-Takt) jeweils einfach textiert, weist unser Autograph jeweils eine zweistrophige Vertonung auf (hier extra mit I. und II. bzw. III. und IV. nummeriert).
3. Der Schlussabschnitt ist in der Berliner Fassung gegenüber der unsrigen kürzer; insbesondere hat unsere Fassung eine bemerkenswerte Schlusskadenz, die in der Berliner Fassung nur durch Fermaten angedeutet ist. Generell fallen noch einige zusätzliche Auszierungen in der ohnehin an Melismen reichen Vokalpartie und Varianten in der Klavierstimme auf.
Unser Manuskript, das anscheinend als eine Weitergestaltung der (wohl älteren) Berliner Fassung anzusehen ist, darf als eine bedeutende Entdeckung für die Loewe-Forschung gewertet werden.
MARX, Adolph Bernhard (1795–1866): Eigenh. Albumblatt m. U. für Carl Gurckhaus, o. O., 21. April 1856, mit Notenzitat Aus Mose (»Wer bin ich, dass ich zu ihnen gehe?«) in Klavierauszug, 9 Takte. 1 Blatt in quer-4to (20,5×27cm).
Bestell-Nr.: 56/34 Preis: € 280,--
Wie so viele andere Musiktheoretiker, hat auch Marx komponiert. Das Oratorium »Mose« ist 1844 in Leipzig uraufgeführt worden.
METHFESSEL, Albert (1785–1869): Eigenh. Albumblatt m. U. für Carl Gurckhaus, o. O., 19. Juli 1861, mit dem Fragment einer Vokalpartie (befindet sich auf einem unregelmäßig beschnittenen Stück stärker gealterten Papiers, das auf den Albumblatt-Vordruck (mit reichem Zierrahmen, 20,5×26,5cm) aufgeklebt worden ist.
Bestell-Nr.: 56/35 Preis: € 200,--
Über dem Notenzitat ist eine Überschrift, die sich auf den größeren Linienabstand des Notensystems bezieht: So weite Linien braucht Herr A. Methfessel, um Noten daraufzuschreiben.Unterschrift und Datierung befinden sich auf dem Stammbuchblatt.
NEUKOMM, Siegismund von (1778–1858): Eigenh. Albumblatt m. U. für Carl Gurckhaus, Leipzig, 3. Dezember 1859, mit einem vier Takte umfassenden Einstimmigen Kanon im Einklang (»Fugit irreparibele tempus«). 1 Blatt in quer-4to (20,5×27cm).
Bestell-Nr.: 56/38 Preis: € 450,--
Neukomm komponierte unzählige Kanons; der vorliegende war bereits in Berlin am 18. November 1841 entstanden (s. eigenes Werkverzeichnis Nr. 733). Der Komponist hielt sich zwischen dem 29. November und dem 15. Dezember 1853 in Leipzig auf (s. Angermüller, S. 18).
OFFENBACH, Jacques (1822–1880). Eigenh. Musikmanuskript mit Skizzen und einer Kammermusik-Komposition, o. O, undatiert, o. U. 3 S. in querfolio. Doppelbl. mit maschinenrastriertem Notenpapiers (12 Systeme, o. Wasserzeichen): S. 1: einige flüchtige Notenskizzen; S. 2+3: Reinschrift einer Komposition, dienicht zu Ende geschrieben ist; die letzte Seite ist unbeschrieben. Außenseiten etwas gebräunt und fleckig (oberer Blattrand unerheblicher Einriss); Bereich der Niederschrift hingegen sehr gut.
Bestell-Nr.: 58/37 Preis: € 1.900,--
| Hauptseite | Seitenanfang | Bestellen |